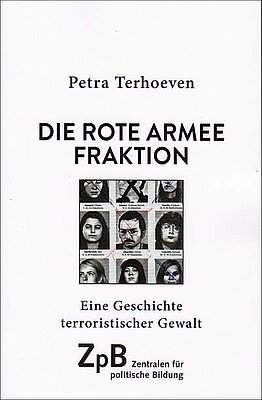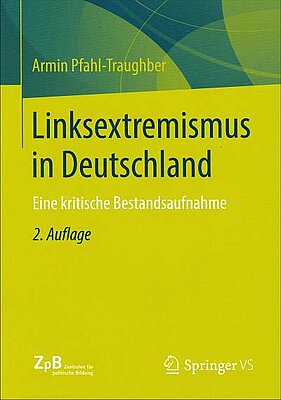Herausgeber: HLZ, Ref. I/2
„Sozusagen ist man in der Zelle frei.“ Spuren der Radikalisierung in Andreas Baaders Gefängnisnachlass des Jahres 1968 bis 1969
PD Dr. Alex Aßmann
Brandanschläge gegen Frankfurter „Konsumtempel“
In der Nacht auf den 3. April 1968 legten vier junge Leute aus dem Umfeld der außerparlamentarischen Opposition (APO) Brände in zwei Frankfurter Kaufhäusern. Dass es ausgerechnet die Stadt Frankfurt am Main treffen sollte, stand nicht von vornherein fest. Ganz zufällig war es aber wohl auch nicht, denn in jenen Jahren war die Hessen-Metropole zugleich eine APO-Metropole. Den Gerichts- und Anwaltsakten nach zu urteilen, ergab sich die Gelegenheit zu den Brandanschlägen auf der Durchreise: Drei der „Brandstifter“, wie sie schon bald genannt wurden, kamen aus Westberlin, einer aus München. In München waren sie losgefahren und auf dem Rückweg nach Berlin hatten sie in Frankfurt einen Zwischenhalt eingelegt.
Der Kontakt zu einer Cutterin beim Hessischen Rundfunk, die keinen der vier persönlich kannte und bei der sie übernachteten, kam wahrscheinlich über die Berliner Kommune 1 zustande, mit deren Mitgliedern nämlich auch die Cutterin schon seit längerem in regem Austausch stand. Noch in derselben Nacht, nachdem die vier bei der Frau eingetroffen waren, setzten sie die Warenhäuser in Brand, fast, als wollten sie auch das noch rasch erledigen, bevor es weiter nach Berlin ging.
Unter reger Beteiligung der Medien [1] endete am 31. Oktober 1968 der „Brandstifterprozess“ mit Haftstrafen von jeweils drei Jahren für alle vier Angeklagten. Im Juni 1969 kamen sie vorübergehend auf freien Fuß und setzten sich Ende des Jahres mehrheitlich ins Ausland ab, um ihre Reststrafe nicht antreten zu müssen. Zwei der „Brandstifter“, Andreas Baader und Gudrun Ensslin, sollten wiederum ein gutes halbes Jahr später als Mitbegründer und Mitbegründerin jener Gruppe, die sich dann Rote Armee Fraktion (RAF) nannte, zu noch größerer Bekanntheit gelangen.
Die eigentliche Geburtsstunde der RAF?
Da erstaunt es nicht weiter, wenn die Entstehung der RAF häufig mit den Brandanschlägen in einen Zusammenhang gerückt wird – und dies auf irgendeine Weise auch auf einen Radikalisierungsprozess schließen lässt. Schon damals nahm man es so wahr, dass mit den Kaufhausbränden die ohnehin radikalisierten APO-Proteste ein neues Niveau der Militanz erreicht hatten. Hierfür schien nicht nur der enorme Sachschaden zu sprechen, der in den Kaufhäusern entstanden war. Dass dabei scheinbar die Gefährdung von Menschenleben in zumindest fahrlässiger Weise in Kauf genommen worden war, schien zusätzlich für eine qualitativ gewandelte Form der Gewaltbereitschaft in der Protestbewegung zu sprechen.
Eine andere Deutung stellt die Brandanschläge in einen Zusammenhang mit einer damals auch weit über das radikale Milieu hinaus verbreiteten Ablehnung der „Konsumgesellschaft“. Sogar in der intellektuellen Kulturkritik, bei den Kirchenverbänden oder in der Pädagogik wurde die Auffassung vertreten, bei dem zeitgenössischen „Massenkonsum“ handele es sich eigentlich um eine Art „Massenmanipulation“ oder „Entfremdung“. Demnach wäre mit den Frankfurter Brandanschlägen auf militantere Weise etwas innerhalb der Protestbewegung zum Ausdruck gekommen, was latent schon in anderen Diskurszusammenhängen mitschwang.
Eine dritte Interpretation ist hingegen rückdatierend entstanden und hängt mit der bereits erwähnten personellen Kontinuität zusammen – dass also die „Brandstifter“ Baader und Ensslin später als RAF-Gründer und -Gründerin erneut auf die Bühne traten. Und tatsächlich stellte der „Konsumterror“ ein stets wiederkehrendes Motiv in den Verlautbarungen der RAF dar, wenn diese etwa angab, der „bewaffnete Kampf“ werde auch im Namen all derer geführt, „die für die Ausbeutung, die sie erleiden, keine Entschädigung bekommen durch Lebensstandard, Konsum, Bausparvertrag, Kleinkredite, Mittelklassewagen“. [2] So etwas begünstigt natürlich die Annahme, dass bereits in den Brandanschlägen der Gewaltkern der späteren RAF angelegt gewesen sei.
Nur wird an diesen drei „Standarderzählungen“ noch etwas anderes deutlich: Das ihnen jeweils zugrunde liegende Konzept von Radikalisierung, mit dem sie gedanklich explizit oder implizit operieren, erkennt in den Brandanschlägen die maßgebliche Zäsur, wohingegen der Gerichtsprozess und die Haft außen vor bleiben. Außerdem bezieht sich die darin jeweils artikulierte Idee von Radikalisierung entweder auf Dynamiken innerhalb einer Protestbewegung, oder auf den Grad der Ablehnung der damaligen Konsumpraxis, wie er sich auch in kulturkritischen Diskursen artikulierte. Oder sie bezieht sich auf die Gewaltideologie einer ohnehin schon militanten Gruppierung, die gerade zum Absprung in den Terrorismus ansetzte. Das sind jeweils sehr verschiedene Gegenstände. Nur eines kommt darin kaum zur Sprache: die Radikalisierung von Individuen. Somit bleibt auch die Art und Weise, wie hier über Radikalisierungsprozesse geredet wird, eigentümlich abstrakt. Denn wie sollen sich „Diskurse“, „Bewegungen“ und „Gruppierungen“ von selbst radikalisieren? Ohne Individuen können sie es kaum.
Gefängnisnachlass legt die Radikalisierung offen
Wie sich eine Etappe der Radikalisierung individuell darstellt, ist in den Gefängnistagebüchern und -briefen [3] Andreas Baaders sehr gut zu erkennen. Genau genommen handelt es sich dabei sogar um ein besonders anschauliches Exempel, weil sich in seinen Tagebüchern und Briefen ein – nun ja – radikales Umdenken in Bezug auf so elementare Empfindungen wie Wut oder Hass nachzeichnen lässt. Parallel dazu, auch das lässt sich daran gut aufzeigen, veränderte sich sein Denken in einem formaleren Sinne (und nicht nur emotional).
Somit durchkreuzt diese Quelle in gewisser Weise die zuvor erwähnten Deutungsangebote. In den Tagebüchern und Briefen geht es nämlich zunächst gar nicht so sehr um konsumfeindliche Diskurse, die Baader zur Tat motiviert hätten, oder wie er sich von Radikalisierungsdynamiken innerhalb der Protestbewegung mitreißen ließ. Nicht einmal die Brandanschläge oder deren mutmaßliche politische Hintergründe spielen eine herausragende Rolle darin. Eher schon lassen die Tagebücher einen Zusammenhang zwischen Baaders individueller Radikalisierung, dem Gerichtsprozess und der Erfahrung des Gefängnisaufenthalts erkennen. Zudem geben sie, aber auch Teile seines Briefwechsels, Auskunft darüber, mithilfe welcher Praktiken er seine Radikalität steigerte und vertiefte, auf welche Weise er in dieser Zeit also „an sich arbeitete“, um weitaus radikaler wieder aus der Haft entlassen zu werden, als er es zum Zeitpunkt seiner Verhaftung am 4. April 1968 schon gewesen war.
Von der Sachbeschädigung zur Gewalt
Tagebuch führte Baader in diesen 14 Monaten durchgängig. Und so protokollierte er mitunter auch seine Gedanken und Überlegungen zu der etwas misslichen Lage, in die er sich hineinmanövriert hatte, und welche Schlüsse er daraus zog. Dachte er in den ersten Wochen seiner Haft etwa darüber nach, was er eigentlich unter Gewalt verstand, klang alles, was ihm hierzu einfiel, noch einigermaßen konventionell. Als Beispiele fielen ihm anfänglich in erster Linie Schulhofprügeleien ein, in die er als Junge manchmal verwickelt war. Was er sich unter Gewalt vorstellte, spielte sich also zwischen Personen ab – und es fiel ihm anfangs mithin schwer, eine Verbindung zwischen den Brandanschlägen und seiner Vorstellung von Gewalt herzustellen. Bestenfalls eine erweiterte Form der Sachbeschädigung erkannte er darin, denn es sei ja nicht seine Absicht gewesen, jemanden zu verletzen. Welche Absicht er mit den Brandanschlägen eigentlich verfolgte, konnte er aber selbst nicht genau sagen.
Kurz vor seiner überraschenden Haftentlassung klang all das jedoch anders. In seinen späten Tagebucheinträgen wirken seine Schilderungen zur Gewalt viel abstrakter. Eigentlich beschrieb er dann eher ein System, das alle sozialen Phänomene zu einer Struktur zusammenfügt, aber nicht mehr die Handlungen unter Menschen. Wenige Wochen vor seiner überraschenden Freilassung war Gewalt für ihn auch „keine Frage mehr“, wie er in sein Tagebuch schrieb. Ihn interessierte da nur noch, „wie wir sie effektiv einsetzen.“ Auch der Unterschied zwischen Gewalt und Sachbeschädigung spielte ab da keine große Rolle mehr für ihn. Vielmehr hieß er jetzt „Gewalt gegen Sachen“ gut, weil sich nur so noch „ein Bewusstsein provozieren lasse.“
Demzufolge ordnete er bereits nach rund 12 Monaten in Haft nicht nur die Brandanschläge kategorial anders ein als noch zu Beginn, weil er sie sozusagen als kommunikative Akte und Gewalthandlungen zugleich begriff. Zudem war er im gleichen Atemzug zu neuen Selbsterkenntnissen gelangt. Noch vor der Haft, so Baader, habe er „ein unterdrücktes und insofern unbegriffenes Verhältnis zur Gewalt“ gehabt. Doch jetzt sehe er „(unter dem Druck der Vollzugsorgane) die Sache anders: ich halte Gewalt gegen Menschen für notwendig und legitim!“ Aus jemandem, der Schulhofprügeleien als gewalttätig wahrnahm, war jemand geworden, dem es einerlei ist, ob Gewalt sich gegen „Sachen“ oder Menschen richtet, solange sie nur ein „Bewusstsein provoziert“. Das ist kein ganz kleiner Schritt, sondern ein großer Sprung.
Von der Wut zum Hass
Ähnlich verhält es sich in seinen Beschreibungen bestimmter Affekte. Während in seinen frühen Tagebüchern häufig von einer diffusen Wut gegen „Autoritäten“ oder – wie er gerne sagte – „Bürokraten“ die Rede ist, verändert sich auch hier die Tonlage um den Urteilsspruch herum recht drastisch. Dann sind in den Tagebüchern nämlich nur noch Schilderungen eines tiefsitzenden Hasses gegen den Staat und seine Organe zu lesen. Belasteten ihn außerdem die Haftumstände anfangs noch sehr, hatte sich auch dies gegen Ende hin grundlegend geändert. Wie er seiner Mutter zu dieser Zeit schrieb, fand er es dann im Gefängnis „gar nicht schlecht“, weil ihn nur hier etwas umgab, „was in dieser Gesellschaf trotz allem, was wir wissen, so schwer, für uns so schwer zu begreifen ist, Hass.“ Wiederum einige Wochen später ist in seinem Tagebuch sogar der denkwürdige Satz zu lesen: „Sozusagen ist man in der Zelle frei.“ Aber kaum gefiel es ihm darin so gut, kam er ironischerweise wieder frei.
Jahre später hatte es in Stammheim [4] der Justizvollzugsbeamte Horst Brubeck mit Baader zu tun. Er erinnerte sich, wie dieser einmal der Gefängnisleitung Baupläne vorgelegt hat, um seine Verbesserungsvorschläge zu präsentieren: „Draußen, vor dem RAF-Trakt, darf sich ruhig ein Bollwerk der Sicherheit auftürmen; im Inneren jedoch soll man […] nur Freizügigkeit spüren.“ [5] Natürlich hatte das vor allem einen propagandistischen Zweck. Denn je einschüchternder das Gefängnis alleine architektonisch wirkte, umso mehr schien das die Rede von der „Vernichtungshaft“ [6] zu untermauern, mit der draußen neues RAF-Personal rekrutiert werden sollte. Dass Baader sich jedoch überhaupt „in der Zelle frei“ und im Gefängnis sozusagen autonom fühlen konnte, so weit war er bereits 1969 gewesen.
Radikalität, die auf sich selbst verweist
Häufig steht die Frage nach der Radikalisierung einer Person in einem Zusammenhang mit ihren ideologischen Bezügen – was sicher nicht unbegründet ist, aber auch auf den Holzweg führen kann. Wenn sich z.B. eine Person durch Lenins frühe Schrift „Staat und Revolution“ in den Bann gezogen fühlt und dieser Text sich scheinbar als richtungsweisender Treiber entpuppt, könnte man sich fragen, weshalb der eine Mensch sich von dem entfesselten Klassenhass und der totalitären Energie genau dieses Buchs so mitreißen lässt, während jemand anderes nichts als langweilige Abstraktionen, gähnende Inhaltsleere und hölzerne Sätze darin erkennt. Und vielleicht käme man zu dem Schluss, dass die eine Person ganz einfach eine starke „Neigung“ zum Totalitären bereits mit sich bringt, wohingegen die andere eventuell psychisch etwas ausgewogener ist.
Doch hätte dann ein Radikalisierungsprozess auch einen selbstreferenziellen Aspekt. Das bedeutet: Jedem Schritt, der tiefer in die Radikalität hineinführt, ginge schon einer vorher; Radikalität setzte sozusagen Radikalität bereits voraus. Um bei dem Beispiel zu bleiben: Nicht „Staat und Revolution“ löst die Radikalität aus, sondern verstärkt die bereits vorhandene nur, lenkt sie in eine Richtung, intensiviert sie, auch wenn sie davor nichts mit einer bestimmten Ideologie zu tun hatte. Für die Analyse von individuellen Radikalisierungsprozessen hätte dies jedoch zu bedeuten, dass die Suche nach einem „ausschlaggebenden Ereignis“ oder einem „allesentscheidenden Text“, den jemand gelesen hat, wahrscheinlich an der Sache vorbeiführt. Denn je weiter man in der Biografie einer Person zurückgeht, desto wässriger dürfte erscheinen, was dann noch an konkret Ausschlaggebendem zu erkennen ist.
Anders stellt es sich jedoch in umgekehrter Richtung dar. Folgt man der Radikalisierung im Lebenslauf nach vorn und nimmt so ihre Spur auf, dann lässt sich Ausschau danach halten, an welchen mitunter weit verstreuten Stellen sich zunächst ein besonders ausgeprägtes Engagement zu zeigen beginnt, ab wann es sich verfestigt und bestimmter wird (und in Bezug auf welche Themen genau) und wie die Person diese vielleicht sehr verschiedenen Dinge, für die sie „brennt“, nach und nach miteinander verknüpft und ihnen Kohärenz verleiht.
Weiterhin ließe sich dann fragen, ab welchem Punkt sie es schließlich so weit vorantreibt, dass sie z.B. moralische Prinzipien übernimmt, die im völligen Gegensatz zu ihren früheren Einstellungen stehen. Dann, und erst dann, mag vielleicht auch ein Buch oder ein Fernsehbericht den Ausschlag geben. Aber die Pfade in die Radikalität hätte die Person für sich bereits vorher geebnet, ohne sie jedoch unter diesem Gesichtspunkt zu reflektieren.
Vom „Roman der Radikalität“ zur „Sprache der Justiz“
Fragt man sich bei Andreas Baader, wofür er sich in besonderem Maße engagiert zeigte, geben seine Tagebücher eine zunächst unerwartete Auskunft. Denn alles, wovon sie am Anfang handeln, dreht sich um das Lesen und Schreiben – und wie sehr ihn die Haft frustrierte. Dabei ging es ihm nicht um bestimmte Texte, sondern um die Kulturtechniken als solche. Lesen und Schreiben begeisterte ihn – ob er nun Lenin oder Marx oder etwas ganz anderes las, war ihm zunächst nicht so wichtig.
Letztere interessierten ihn kurz nach der Verhaftung so wenig wie z.B. der Krieg in Vietnam, obschon die Brandanschläge angeblich ein „Fanal“ dagegen hatten setzen wollen. Baader bekannte indessen recht freizügig, dass ihn – wenn er ehrlich zu sich war – der Vietnamkrieg eigentlich nicht berührte. Es löste nichts in ihm aus, wenn er daran dachte, keine Wut, keine Trauer, keinen Hass. Selbst das Attentat gegen Rudi Dutschke bedeutete ihm nicht viel, obwohl er ihn doch persönlich kannte. Darüber wunderte sich schon Gerd Koenen ein wenig, als er Baaders ersten Brief an die Kommune 1 vom 17. April 1968 las: „Zur Lage draußen nur die furztrockene Frage: ›Dutschke tot?‹“ [7] Aber Lesen und Schreiben! Das löste sehr intensive Empfindungen in ihm aus. Je exzessiver er beides betrieb, umso heftiger.
Statt Revolutionsliteratur zog ihn jedoch anfangs noch Sprachphilosophie ganz besonders in den Bann. Nachdem er sich einige Zeit sehr konzentriert mit Ludwig Wittgensteins „Tractatus logico philosophicus“ beschäftigt hatte, notierte er sich etwa: „Ich setze mich auf Wittgenstein wie auf ein Pferd, wie man sich draufsetzt und über Mauern setzt.“ Auch Biografien von Schriftstellerinnen und Schriftstellern interessierten ihn sehr. Kaum hatte er einen Nachruf auf die Blindenpädagogin Helen Keller gelesen, findet sich in seinem Tagebuch die Notiz: „Im Gefängnis bin ich wach, wenn ich Briefe lese, wie ein Blinder hört. Helen Keller. Das Geheimnis Helens: Sie erfand die Welt. Etwas ähnliches geschieht hier.“ Ganz sicher sind das bemerkenswerte Tagebucheinträge, nur politisch sind sie nicht.
Trotzdem führte im weiteren Verlauf seine Beschäftigung mit Sprachphilosophie dazu, dass er mit Begeisterung die „Sprache der Justiz“ sezierte, die ihn während der Verhandlungstermine und in seiner Anwaltspost umgab. Langsam begann er sich eine Welt auszumalen, die ihm durch Gesetzesvorgaben vollständig durchreguliert erschien, als wäre sie selbst auf Gesetzestexten erbaut. Die Leute, so schien es ihm zunehmend, konnten nur leben, wie es ihnen nicht verboten war, aber nicht, wie sie wollten.
In diesem Zuge näherte er sich zugleich der Einsicht an, dass er „in seiner Zelle frei“ war. Hier konnte er unbegrenzt lesen und schreiben, mit Wittgenstein über Mauern segeln und wie Helen Keller ganze Welten erfinden. Dann steht da sogar: „Ich bin Dichter. Ich lebe einen Roman.“ Immer wieder finden sich in seinen Notizen Andeutungen darüber, dass seine intensiven Leseerfahrungen stets auch mit dem Gefängnisaufenthalt verbunden waren („über Mauern setzen“). Was in gewisser Weise auch nachvollziehbar ist. Denn in einer Gefängniszelle, zwischen den immergleichen Wänden, in einer stark reizgeminderten Umgebung, können Texte besonders intensiv wirken. Wenn sich die Aufmerksamkeit gezwungenermaßen sehr fokussiert nach innen richtet, reagiert auch die Psyche stärker auf alles, was „innere Bilder“ entstehen lässt. Texte können das stark anregen. Nur ist eine sprachphilosophische Abhandlung nicht unbedingt mit einem Karl May-Roman zu vergleichen.
„1968“ als Lesebewegung
Allerdings war „1968“ auch eine „Lesebewegung“, wie Detlef Siegfried unlängst wieder hervorgehoben hat [8] – und wie sich durch Philipp Felschs These untermauern ließe, dass um „1968“ herum „Theorie“ als literarische Gattung zu florieren begann. [9] Selbst solche Bücher, wie sie in der edition suhrkamp erschienen, las man eher wie Romane als wie im Hermeneutik-Seminar. Eher ging es um Leseerfahrungen und nicht um die richtige oder falsche Auslegung. Ohne dass er sich besonders für deren politische Motive interessierte, schien sich selbst Baader, der Schulabbrecher, in die „Bewegung“ sozusagen „eingelesen“ zu haben – auch wenn er dabei im Gefängnis saß.
Dort gingen seine Wittgenstein-Notizen immer häufiger in solche zur „Sprache der Justiz“ über. Schließlich folgten (im Stile Wittgensteins geschriebene) eigene „logische“ Abhandlungen zu „neuen Proteststrategien“, die sich in der Gerichtsöffentlichkeit abspielen und in Gefängnisrevolten münden sollten. Über die „Lesebewegung“ von 1968 fand er also dann doch noch zu deren politischen Themen. Dass er sich ausgerechnet im Gefängnis besonders autonom fühlte, mochte zunächst noch paradox erscheinen, lässt sich aber anhand seines gewandelten Verhältnisses zu Texten erklären. Denn mit deren Hilfe löste er diese augenscheinliche Widersinnigkeit gleichsam auf, indem er sich in einen politisch handlungsfähigen Akteur verwandelte.
Doch scheint noch etwas Anderes von außen her paradox, was ihm selbst aber umso stimmiger erschien. Je abstrakter nämlich Baader die Dinge zu sehen lernte, desto empfindsamer wurde er in sozialer Hinsicht. Einerseits kann man in seinen Tagebucheinträgen nachzeichnen, wie die Schilderungen eines gesellschaftlichen Gewaltsystems und des Justizapparats immer abstrakter werden. Andererseits mehren sich parallel dazu auch seine Schilderungen von Solidarität und Mitgefühl für die Menschen um ihn herum. Nachdem er von Wittgenstein zu Marcuse und Fanon übergegangen war, erkannte er sogar in seinen Mitgefangenen bemitleidenswerte Gestalten, die durch den „Dreck, den sie gezwungen sind zu produzieren und zu kaufen“, noch mehr „verhöhnt“ wurden als durch „die Bourgeoisie“. Er identifizierte sich mit ihnen. Sie alle wurden auf dieselbe Weise erniedrigt. Wer im Getriebe von Produktion und Konsum nicht mehr mithalten konnte, der landete hier, wo er selber war: im Knast.
Das Briefkolloquium der Elite-Gefangenen
Ob in Briefen an seine Mutter oder an Gudrun Ensslin, kokettierte er dann auch ganz gerne damit, dass er in seiner Zelle im Grunde „wie ein Mönch“ hauste. Ganz so isoliert und auf sich selbst bezogen ging seine Lese- und Schreibpraxis indes nicht vonstatten. Denn er hatte beim Lesen oder Schreiben immer auch Andere im Sinn, zu denen er sich gleichsam in ein intellektuelles Verhältnis setzte und Vergleiche zog.
In erster Linie war das freilich Gudrun Ensslin, mit der er sich per Brief über ihre gemeinsamen Lektüren austauschte. Darüber hinaus verglich er sich auch mit den Mitgefangenen Proll und Söhnlein, die sich aber nicht in dem von ihm erwünschten Umfang an dem Briefwechsel beteiligen, den Ensslin und er pflegten, weil sie mit der Haftsituation seelisch schlechter zurechtkamen. Als ihm das auffiel und es sich nicht besserte, wurde auch sein Tonfall abschätziger, wenn er über sie schrieb. Umso wichtiger schien es ihm nun, dass wenigstens sie beide, er und Ensslin, bei der Stange blieben und weiterhin ihr straffes Text- und Briefprogramm durchzogen.
Je mehr sich das intensivierte, umso weniger „intellektuell“ erschienen ihm dann aber auch die Mitglieder der Kommune I [10], denen er anfänglich noch mit Hochachtung begegnete. Man wolle ja nicht so enden wie der „frustrierte [Fritz] Teufel“, schrieb er Ensslin dann: „Ich erinnere mich, dass er kaum ein Wort herausbrachte“ nach seiner letzten Haftentlassung. Womit er ihr zugleich suggerierte: Die Kommunarden ließen sich zwar gerne medienwirksam verhaften, aber noch lieber kamen sie aus dem Gefängnis wieder heraus. Wenn sich dann einmal ein Entlassungstermin etwas länger als erwartet hinauszögerte, wie zuletzt bei Teufel, dann sah man sie nur noch geknickt herumlaufen. Offenbar begriff Baader die Haft auch als eine Art Härtetest und das Lesen und Schreiben erfüllte in diesem Zusammenhang zusätzlich eine therapeutische Funktion.
Aber genau hieran, so Baader, mussten sie beide arbeiten, wollten sie nicht so kläglich enden wie Fritz Teufel in seinen Augen. Natürlich sei bei ihrer Verhaftung auch eine Menge Pech im Spiel gewesen, schrieb er Ensslin, aber „warum soll es kein Glück sein?“ Im Grunde mussten sie doch nur ihre Haltung zum Gefängnis und zu ihrer biografischen Vergangenheit ändern. Dann zeige sich schon, so Baader, was es hier zu gewinnen gäbe: an „der bürgerlichen Existenz scheitert jeder“, erklärte er ihr kurz vor Verhandlungsbeginn. Sie aber hätten endlich die einmalige Chance erhalten, zu zeigen, dass es auch in umgekehrter Richtung funktioniert und die „bürgerliche Existenz […] an uns gescheitert“ war.
Ensslin ging darauf ein. Danach ist auch ihren Briefen anzumerken, wie sie die Ablehnung des Gefängnisses aktiv abzubauen versucht, indem sie es kurzerhand zur Lernumgebung umdeutet. Hatte sich Baader eben noch notiert, dass er Ensslins Briefe las, „wie ein Blinder hört“, findet sich wenig später auch in einem ihrer Briefe die Formulierung: „ich sehe deinen Brief.“ Oder hatte er gerade erst in seinen Mitgefangenen das dem Hohn der herrschenden Klasse ausgesetzte Proletariat und im Hass eine im Gefängnis frei verfügbare Ressource für Lernprozesse erkannt, ist bald darauf auch bei ihr zu lesen: „wo kann man noch so einfach lernen wie hier: die 2 Klassen, die mit und die ohne Schlüssel, und alle daraus folgenden Erscheinungen […].“ [11]
Praktiken, Kontexte und Themen der individuellen Radikalisierung
Vor allem das Agieren vom Gefängnis aus und ihre strategische Konzentration auf Gerichtsprozesse prägten nach 1972 immer deutlicher das spezifische Handlungsprofil der RAF. Im Briefwechsel zwischen Andreas Baader und Gudrun Ensslin lässt sich rekonstruieren, wie zwei ihrer Protagonistinnen und Protagonisten wichtige persönliche Voraussetzungen dafür im Kontext des „Brandstifterprozesses“ entwickelten.
Dabei wird deutlich, dass beide in ihrer jeweiligen Radikalisierung therapeutische und intellektuelle Praktiken miteinander verknüpften. Alles, was sie schreiben und lesen, hat für sie zu dieser Zeit auch den Zweck, im Gefängnis nicht die Nerven zu verlieren. In diesem Zusammenhang eigneten sie sich ein revolutions- und klassentheoretisches Vokabular an, das beiden zuvor noch unzugänglich war. Die Synthesen, die sie daraus destillierten, unterstützten sie zugleich darin, das Gefängnis und den Strafvollzug als etwas Anregendes und ihre Kreativität Herausforderndes anzunehmen. Von diesem Standpunkt aus interpretierten sie schließlich ihre Biografien völlig neu. Dass sie im Gefängnis saßen, erschien ihnen jetzt nicht mehr als Bruch oder Niederlage, sondern als Gewinn und als eine unverhoffte Möglichkeit des Neubeginns.
Allerdings geht ihre Radikalisierung auch mit einem eigentümlichen Bildungseifer einher, der ihren Briefwechsel und insbesondere auch Andreas Baaders Tagebücher durchdringt. Mit Andreas Baader und Gudrun Ensslin hatten allerdings auch ein zeitgenössischer Bildungsverlierer und eine Bildungsaufsteigerin zueinander gefunden. In Zeiten einer sprunghaft verlaufenden Bildungsexpansion hätte es Andreas Baader, als Sohn eines Kunsthistorikers, wenig Mühe kosten sollen, sich von der Aufstiegswelle einfach mitreißen zu lassen. In seine Bildung war außerdem viel, aber erfolglos investiert worden.
Gudrun Ensslin, eine Pfarrerstochter aus der schwäbischen Provinz, hatte es hingegen bis ins zeitgenössische Kulturestablishment Berlins hineingeschafft und konnte sich über längere Zeit eher auf der Gewinnerseite jenes gesellschaftspolitischen Transformationsprozesses sehen. Erkämpfen musste sie es sich dennoch, zugeflogen war es ihr nicht. Eine Stiftungsförderung wurde ihr erst beim dritten Anlauf zugesprochen. Nur war bis dahin auch für sie der Weg nach oben durch Zurückweisungen und Herabsetzung geprägt. Somit erfüllte sie die zeitgenössische Aufstiegsnorm einerseits, und wurde dennoch andererseits auf Distanz gehalten. Was sie leistete, genügte nie so ganz. Am Ziel endlich angelangt, schmiss sie alles wieder hin.
„Sozialer Aufstieg durch Bildung“ war eines der großen Versprechen der „langen Sechzigerjahre“. Selten waren „Bildung“ und „Demokratie“ in der deutschen Geschichte einmal leitmotivisch so eng miteinander verknüpft gewesen, wie in diesen Jahren. Für Baader löste sich dieses gesellschaftspolitische Aufstiegsversprechen nicht ein. Auch gegenüber einer anderweitig so strebsamen und leistungsbereiten jungen Frau wie Gudrun Ensslin sträubte man sich sehr lange, sie auch institutionell anzuerkennen.
Wo jedoch ganz emphatische Hoffnungen in die Demokratie auf Bildungskarrieren projiziert werden, vergrößert dies die Fallhöhe enorm, sollten sich damit verbundene Aufstiegserwartungen nicht erfüllen. Aber wer sich nicht zuerst mit etwas identifizierte, hasst es später nicht. Scheitern Bildungsverläufe, kann dies unter gewissen Umständen auch als Scheitern der Demokratie verstanden werden. Und so ließen sich vielleicht auch andere Radikalisierungsverläufe in einen Zusammenhang mit politischen Aufstiegsversprechungen bringen, die in unterschiedlichen Epochen jeweils anders lauten und sich auf längere Sicht vielleicht im statistischen Mittel tendenziell erfüllen lassen. Für eine Großzahl von Einzelfällen erfüllen sie sich aber ebenso regelmäßig nicht. Und hier mag dann vielleicht in Hass umschlagen, was zunächst mit großen Hoffnungen begann.
Zum Autor
PD Dr. Alex Aßmann
ist Erziehungswissenschaftler, freier Autor und seit November 2023 Mitarbeiter am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt/Main, davor am Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen. Letzte Buchveröffentlichung: „Gudrun Ensslin: Die Geschichte einer Radikalisierung“, Leiden 2018 (Verlag Ferdinand Schöningh). Derzeit schreibt er eine neue Biografie Andreas Baaders auf der Grundlage dessen Gefängnisnachlasses des Jahres 1968/69.
Quellenverzeichnis
Das Stammheim Protokoll: https://www.stammheim-prozess.de.
Ensslin, Gudrun und Vesper, Bernward: »Notstandsgesetze von Deiner Hand«: Briefe 1968/69. Frankfurt a. Main 2009.
Felsch, Philipp: Der lange Sommer der Theorie: Geschichte einer Revolte 1960-1990. München 2015.
International Institute of Social History: https://search.iisg.amsterdam/Record/ARCH02998/ArchiveContentList.
Koenen, Gerd: Das rote Jahrzehnt: Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977. Frankfurt a. M. 2003 (3. Aufl.).
Koenen, Gerd: Vesper – Ensslin – Baader: Urszenen des deutschen Terrorismus. Köln 2003 (3. Aufl.).
Mauz, Gerhard: Mit voller Geisteskraft in ernster Sache. DER SPIEGEL 43/1968: https://www.spiegel.de/politik/mit-voller-geisteskraft-in-ernster-sache-a-e86819e5-0002-0001-0000-000045935363.
Oesterle, Kurt: Stammheim: Der Vollzugsbeamte Horst Brubeck und die RAF-Häftlinge. Tübingen 2007.
Planet Wissen: https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/studentenbewegung/pwiekommune100.html.
Sedlmaier, Alexander: Konsum und Gewalt: Radikaler Protest in der Bundesrepublik. Berlin 2018.
Siegfried, Detlef: 1968: Protest, Revolte, Gegenkultur. Stuttgart 2018.
[1] Vgl. Mauz, Gerhard: Mit voller Geisteskraft in ernster Sache. In: DER SPIEGEL 43/1968: https://www.spiegel.de/politik/mit-voller-geisteskraft-in-ernster-sache-a-e86819e5-0002-0001-0000-000045935363.
[2] Zit. n. Sedlmaier, Alexander: Konsum und Gewalt: Radikaler Protest in der Bundesrepublik. Berlin 2018, S. 151.
[3] Siehe International Institute of Social History: https://search.iisg.amsterdam/Record/ARCH02998/ArchiveContentList.
[4] Siehe Das Stammheim Protokoll: https://www.stammheim-prozess.de.
[5] Oesterle, Kurt: Stammheim: Der Vollzugsbeamte Horst Brubeck und die RAF-Häftlinge. Tübingen 2007, S. 191.
[6] Vgl. Koenen, Gerd: Das rote Jahrzehnt: Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977. Frankfurt a. M. 2003 (3. Aufl.), S. 394 ff.
[7] Koenen, Gerd: Vesper – Ensslin – Baader: Urszenen des deutschen Terrorismus. Köln 2003 (3. Aufl.), S. 161.
[8] Siegfried, Detlef: 1968: Protest, Revolte, Gegenkultur. Stuttgart 2018, S. 69.
[9] Felsch, Philipp: Der lange Sommer der Theorie: Geschichte einer Revolte 1960-1990. München 2015, S. 58 ff.
[10] Vgl. Planet Wissen: https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/studentenbewegung/pwiekommune100.html.
[11] Ensslin, Gudrun zit. n. Ensslin Gudrun und Vesper, Bernward: »Notstandsgesetze von Deiner Hand«: Briefe 1968/69. Frankfurt a. Main 2009, S. 200.